Durch das Projekt "Istarske novine online / Istrian Newspapers Online" (INO) werden alte Zeitungen, Zeitschriften und Jahrbücher, die in Istrien in der zweiten Hälfte des 19. und der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts verlegt wurden, digitalisiert und im Internet veröffentlicht. Den Benützern wird dadurch ermöglicht, die Geschichte Istriens aufgrund der Zeitungen, die in Istrien in kroatischer, italienischer und deutscher Sprache veröffentlicht wurden, zu recherchieren.
Die Universitätsbibliothek in Pula schloß sich damit den aktuellen Bemühungen an, das digitalisierte kulturelle und historische Material, das in den Bibliotheken und anderen Nachlassinstitutionen gehütet wird, einem breiteren Publikum zugänglich zu machen. Zu diesem Zweck initiierte sie im Jahr 2006 das Programm der Digitalisierung von alten Zeitungen im Besitz der Bibliothek, um den Benützern und dem breiteren Publikum einen Zugang zum druckschriftlichen kulturellen Erbe Istriens zu ermöglichen.
Der Zeitungen-Fundus der Heimatssammlung Histrica in der Universitätsbibliothek in Pula enthält 426 Titel (etwa 1800 Jahrgänge) von Zeitschriften, die in Istrien seit 1808 bis heute veröffentlicht wurden.
Im Jahr 2007 startete die Bibliothek das Projekt INO mit der Präsentation der Zeitung „Naša sloga“ (1870 -1915) im Netz, und seit 2008 wird das Projekt mit immer neuen Titeln alter Zeitungen erweitert. Bis heute wuchs ihre Anzahl auf 35 Zeitungen.
Warum haben wir die alten Zeitungen, Zeitschriften und Jahrbücher digitalisiert?
Heute sehen wir, dass im vereinten Europa das Interesse an der eigenen regionalen und lokalen Geschichte unter verschiedenen Aspekten (Kultur, Sozialfragen, Politik, Militärgeschichte, Sport, Unterhaltung) wächst. Die genannten Informationen werden aber gerade in den alten Zeitungen erhalten. Deswegen bleiben diese Materialien eine wichtige primäre Quelle für die Erforschung der Geschichte betreffender regionalen und lokalen Milieus.
Außer internationalen Themen bieten die alten Zeitung auch den besten Einblick in das regionale und lokale (in unseren Fall das istrische) historisch-politische, kulturelle und soziale Bild eines bestimmten Zeitabschnitts. Im Fall des Projekts INO handelt es sich um die zweite Hälfte des 19. und die erste Hälfte des 20. Jahrhunderts. Im historischen Sinne war dieser Zeitraum in Istrien besonders turbulent, weil Istrien in dieser Periode Teil dreier verschiedener Staatseinheiten war: Österreich-Ungarns, Italiens und Jugoslawiens.
Die im Internet präsentierten Zeitungen und Zeitschriften wurden in der deutsche, italienische und kroatische Sprache veröffentlich. Für sie interessieren sich Benützer nicht nur in Europa, sondern auch auf anderen Kontinenten.
Da nur wenige Bibliotheken über alle Ausgaben alter Zeitungen verfügen, macht es ihnen die Digitalisierung möglich, die fehlenden Zeitungsnummern durch ihre Zusammenarbeit auszutauschen und damit die vollkommenen virtuellen Ausgaben jeder Zeitung zu bekommen, unabhängig davon wer der eigentliche Besitzer ihrer Papierausgaben ist. Die Bibliotheken und die anderen öffentlichen Einrichtungen können ihren Benützern dann beibringen, wie sie bestimmte Zeitungen durch das Internet lesen können.
Ziele des Projekts INO
- Alte und rare Zeitungen aus dem Fundus der Bibliothek vor Beschädigung durch Manipulation (das Tragen, Blättern und Zurückbringen auf die Regale) zu schützen.
- die Verfügbarkeit der genannten Zeitungen per Internet: die Benützer brauchen nicht mehr in die Bibliothek zu kommen, um die alten Zeitungen zu lesen. Die Bibliothek selbst „bringt“ gesuchte alte Zeitungen ins Haus (oder in seine wissenschaftliche Einrichtung weltweit).
Das langfristige Ziel dieses mehrjährigen Projekts ist die Digitalisierung und die durch das Netz Verfügbarmachung von etwa 200.000 Seiten der alten istrischen Zeitungen aus dem 19. Jahrhundert und der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts, die in der Universitätsbibliothek in Pula und in den anderen Einrichtungen, die sich um die Überlieferung kümmern, aufbewahrt sind.
Im Laufe der zwölf Jahre wurde das Projekt INO mit immer neuen Titeln vervollständigt. Es leistete einen wesentlichen Beitrag zur Präsentation der im Bereich Istriens entstandenen Überlieferung an ein breiteres Publikum. Durch das Projekt wurden die multikulturellen Werte und der Dialog unter den Kulturen befördert, mit dem Ziel der Stärkung des Verständnisses und der Achtung der kulturellen Mannigfaltigkeit unter den Einwohnern Europas.
Das Verfahren der Digitalisierung
Wegen der Seltenheit der alten istrischen Zeitungen (bis zum Jahr 1945 wurden 157 Titel in 363 Jahrgängen veröffentlicht) und der Gefährdung der Originalausgaben sowie ihrer Schutzbedürftigkeit, entschied man sich im Jahr 2005, bei der Frage mit welchem Bibliotheksmaterial die Digitalisierung anzufangen, ausgerechnet für die inzwischen selten gewordenen alten istrischen Zeitungen. Im Jahr 2007 wurde entschieden, dass die Zeitschrift «Naša sloga» die erste im Rahmen des Programms „Istrische Zeitungen online“ im Internet präsentierte Zeitung sein sollte. Es handelte sich dabei um einige sehr seltene Zeitungsexemplare, die die Bibliothek in den 1950-ger Jahren als Geschenk vom kroatischen Schriftsteller Viktor Car Emin bekam, der in der Zwischenkriegszeit gezwungen war, in das Königreich Jugoslawien zu emigrieren und dabei diese Zeitschriftensammlung mitnahm.
Alte Zeitungen, die in den letzten 12 Jahren digitalisiert wurden, wurden in der Universitätsbibliothek in Pula und in der National- und Universitätsbibliothek in Zagreb auf Mikrofilm aufgenommen. Die fehlenden Ausgaben wurden im Fall von „Naša sloga“ mit Hilfe von originalen Exemplaren, die sich in der National- und Universitätsbibliothek in Zagreb und im Archiv des Bistums Poreč-Pula befinden, auf den Mikrofilm aufgenommen. Damit bekam man ein virtuelles Ganzes (das vollkommene Exemplar aller veröffentlichten Ausgaben, in dem nur wenige Nummern fehlten).
Im Jahr 2005 wurden diese Mikrofilme digitalisiert und im Jahr 2007 die Applikation für die Internet-Präsentation von "Naša sloga" geschaffen. Dadurch wurde fast die komplette Ausgabe dieser alten und seltenen Zeitung im Internet zugänglich.
In der Fortsetzung dieses Projekts wurden im Jahr 2008 drei weitere Titel seltener Tageszeitungen hinzugefügt. Diesmal handelte es sich um die Blätter, die am Anfang des 20. Jahrhunderts in Pula in drei Sprachen (kroatisch, deutsch, italienisch) veröffentlicht wurden: „Polaer Tagblatt“ (1905-1915), „Corriere istriano“ (1934-1938) und „Hrvatski list“ (1915 -1918). Den Benützern wurde damit am Ende des Jahres 2008 ein virtueller Lesesaal in drei Sprachen angeboten, mit etwa 30.000 alten istrischen Zeitungsseiten. In den letzten Jahren fing man ebenso an, alte Zeitschriften und Jahrbücher aus Istrien zu digitalisieren.
Dieses Projekt wird vom kroatischen Kultusministerium, der Gespanschaft Istrien und der Stadt Pula finanziert.
Um PDF-Dateien zu herstellen wurde eine spezielle Software für die Konversion der Foto-Aufnahmen in die PDF-Dateien gebraucht. Die Dateien wurden danach auf einem Server gespeichert. Bei der Beschaffung der Web-Applikation wurde die HTML/CSS Technologie mit der PHP/JavaScript Programmsprache kombiniert. Die PDF-Dateien und die Web-Applikation für die Präsentation des digitalisierten Materials lieferten die Firmen E-scape d.o.o. aus Pula und Point d.o.o. aus Varaždin.
Digitalisierte alte Zeitungen, Zeitschriften und Jahrbücher in deutscher Sprache, die im Rahmen des Projekts INO zugänglich geworden sind http://skpu.unipu.hr/ino/:
- Pola (Wochenzeitung; 1883 – 1885)
- Polaer Tagblatt (Polaer Morgenblatt) (1905-1918)
- Illustrierte österreichische Riviera-Zeitung (1904-1906) aus Pola und Abbazia
- Brioni Insel-Zeitung (1910-1914)
- Mittheilungen aus dem Gebiete des Seewesens
Das Polaer (Pulaer) Zeitungswesen in deutscher Sprache
Pola (heute Pula) war Mitte des 19. Jahrhunderts ein Städtchen von etwa 1000 Einwohnern, das vorwiegend vom Fischfang lebte. Die Stadt begann sich aber in den 1850er Jahren rasch zu entwickeln, nachdem sie zum Hauptkriegshafen der Habsburger Monarchie ernannt wurde. Die Gründung des See-Arsenals 1856 förderte geradezu schlagartig die Beschäftigung, was zu einem bedeutenden Bevölkerungszustrom führte. Offiziere, Techniker sowie Militär- und Staatsbeamte zogen größtenteils aus Teilen des heutigen Österreichs zu. Danach siedelten sich auch Kaufleute, Handwerker und andere private Gewerbetreibende an. Laut Volkszählung im Jahre 1880 bezeichneten sich 3.801 Einwohner Polas (21%) als Alteingesessene, 5.853 (33%) zogen aus dem Gebiet Istriens zu, 5.303 (30 %) aus den übrigen Provinzen Cisleithaniens (der österreichischen Hälfte der Doppelmonarchie), 1.457 (8 %) aus den Ländern der ungarischen Krone und 1.363 (8%) Ausländer, (davon etwa 5% aus Deutschland). Die Anzahl der Zuwanderer erhöhte sich 1876 bedeutend, als Pola über Divača durch das Eisenbahnnetz mit dem übrigen Teil der Monarchie verbunden wurde. 1890 zählte die Stadt annähernd 32.000 Einwohner, 1910 waren es schon 58.562. Innerhalb von nur 60 Jahren (1850-1910) stieg die Zahl der Zivilbevölkerung auf das Vierzigfache. So wuchs Anfang des 20. Jahrhunderts Pola zu einem modernen urbanen Zentrum mit zeitgemäßer städtischer Infrastruktur (Gas- und Stromnetz, Wasserleitungen, elektrischer Straßenbahn, Krankenhaus, Museen, Theater, zahlreichen Schulen mit italienischer, deutscher und kroatischer Unterrichtssprache usw.).
Eine der Besonderheiten Polas, als mitteleuropäischer und zugleich mediterraner Stadt, war die ethnische, kulturelle und sprachliche Vielfalt ihrer Einwohner, wozu die zahlreichen Offiziere und Matrosen, die Arbeiter und Händler erheblich beitrugen, die als Angehörige ihrer Völker in der Monarchie lebten. Während die italienische Sprache unter den Kaufleuten und Arbeitern vorherrschte, überwog das Deutsche bei den Offizieren und Angehörigen der Marine und des Heeres sowie bei den Staatsangestellten, war aber auch bei den Matrosen und Gewerbetreibenden in Gebrauch. Laut Bevölkerungsstatistik von 1880 gab es in der Stadt 3.826 Einwohner, die sich als deutsche Muttersprachler bezeichneten (also jeder sechste Einwohner), 1910 waren es 9.064 (15% der Gesamteinwohnerzahl). 1910 wiesen sich von 16.014 Militärpersonen in Pola 4.853 (30%) als deutsche Muttersprachler aus. Marineoffiziere gehörten der höheren sozialen Schicht an. Sie stammten vorwiegend aus bürgerlichen Familien, zu einem kleineren Teil aus der Hocharistokratie und dem Adel. Diese Adeligen waren meist deutschsprachiger Herkunft.
Obgleich die Deutschen bzw. Deutschsprachigen in Pola eine Minderheit waren, konnten sie dank ihrer Überzahl innerhalb der Marine, ihrer wirtschaftlichen Stärke, guten Organisation aber auch dank staatlicher Unterstützung in der Stadt ihre eigenen Schulen (darunter ein Gymnasium), Vereine und Zeitungen/Zeitschriften in deutscher Sprache gründen und im Rahmen des Marinekasinos auch ein Theater, ein Orchester, einen Konzertsaal und eine Bibliothek einrichten.
Neben den Veröffentlichungen der österreich-ungarischen Kriegsmarine entwickelte sich in Pola eine reiche deutschsprachige Verlagstätigkeit zivilen Charakters. Dies ist das Ergebnis der Vielfalt des kulturellen und gesellschaftlichen Lebens und kultureller Gewohnheiten, die deutsche Offiziere und Staatsbeamte mit ihren Familien aus den Metropolen der Monarchie, aus denen sie in größerer Zahl nach Pola zugezogen waren, mitgebracht haben. Gedruckt wurden Zeitungen (hauptsächlich Wochenblätter), Ausgaben verschiedener Vereine, Schulbücher und andere Handbücher.
Chronologisch kann man das deutschsprachige Zeitungswesen in Pola (Pula) auf zwei Zeiträume aufteilen: Der erste umfasst die Wochenzeitungen, die in den siebziger und achtziger Jahren des 19. Jahrhunderts, und der zweite die Zeitungen, die vom Jahr 1904 bis zum Ende 1918 erschienen (sehe Beilage, Tafel 7). Die Zeitungen aus der ersten genannten Periode waren liberal gesinnt und zweisprachig (Texte wurden in deutscher und italienischer Sprache geschrieben). Beide genannten Wochenzeitungen setzten sich für eine Annäherung und Zusammenarbeit zwischen dem italienischen Bürgertum auf der einen Seite und den Angehörigen der Marine und des deutschen Bürgertums auf der anderen ein: Für die Überwindung der national-partikulären Interessen auf der gemeinschaftlichen Basis der liberalen politischen Überzeugungen. Nach dem Scheitern dieser Bemühungen entwickelte sich das istrische Zeitungwesen (vom Anfang des 20. Jahrhunderts) in Richtung einer Auseinandersetzung zwischen den „gesammtösterreichisch“ gerichteten regierungstreuen deutschsprachigen Zeitungen (in erster Linie der Tageszeitung Polaer Tagblatt) und den nationalistisch gerichteten und bürgerlich-liberalen italienischen Blättern. Ein allgemeines Charakteristikum der politischen Öffentlichkeit in Pula vor dem Ersten Weltkrieg war ihre national-politische Gespaltenheit.
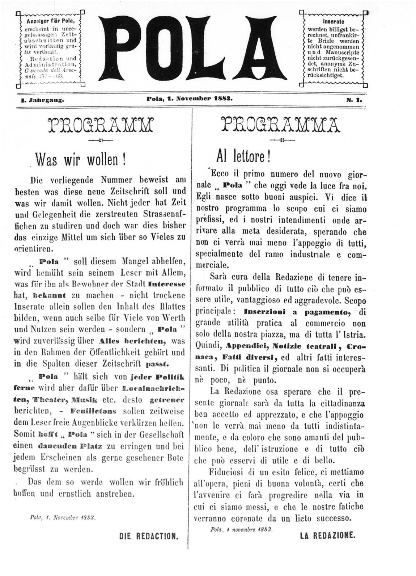
Die Wochenzeitung Pola (1883 – 1885)
Die Wochenzeitung Pola, die vom 1.1.1883 bis 24.12.1885 erschien, hat der Buchhändler und Verleger F.W. Schrinner in Pola herausgegeben, Redakteur war Joseph Fischer. Die Texte wurden in deutscher und italienischer Sprache veröffentlicht, gedruckt wurde in der Druckerei „Rocco e Bontempo“ in Pola. In der ersten Ausgabe trug das Blatt den Untertitel Anzeiger für Pola mit der Ankündigung, dass es unregelmäßig erscheinen und vorläufig gratis verteilt werden würde. Im Leitartikel der ersten Ausgabe steht, dass es das Ziel der Redaktion sei, ihren „Leser mit Allem, was für ihn als Bewohner der Stadt Interesse hat, bekannt zu machen“ bzw. „‚Pola‘ wird zuverlässig über Alles berichten, was in den Rahmen der Öffentlichkeit gehört.“ Gerade darin besteht die geschichtliche Bedeutung der Zeitung in diesem Zeitabschnitt, denn sie ermöglichte die Herausbildung einer bürgerlichen Öffentlichkeit durch Information zu Fragen von öffentlichem Interesse. Weiter wird im Leitartikel vermerkt: „‚Pola‘ hält sich von jeder Politik ferne, wird aber dafür über Localnachrichten, Theater, Musik etc. desto getreuer berichten,– Feuilletons sollen zeitweise dem Leser freie Augenblicke verkürzen helfen.“ Neben dem Angeführten wurden in dem Blatt Leserbriefe, Nachrichten über die Schiffsbewegungen der Marine und Werbeankündigungen veröffentlicht.
Die Tageszeitung Polaer Tagblatt (Polaer Morgenblatt) (1905-1918)
Die einzige deutschsprachige Tageszeitung in Istrien erschien in Pola vom 15.10.1905 bis zum 17.6.1906 unter dem Namen Polaer Morgenblatt und vom 18.6.1906 bis zum 13.11.1918 unter dem Titel Polaer Tagblatt, als mit dem Fall der Monarchie das Blatt eingestellt wurde. Sie wurde mit dem Ziel gegründet, ein österreichisch patriotisches Gegengewicht zur meistgelesenen Tageszeitung II giornaletto di Pola (1900-1915), das das Sprachrohr der regierenden bürgerlich-liberalen italienischen Partei in Pola war, zu werden. Nach den immer stärkeren politischen Konflikten seit 1904/05 zwischen den Angehörigen der Kriegsmarine und der bereits erwähnten anderen Seite, vertrat die Zeitung in der Öffentlichkeit die Interessen der K.u.K.-Marine und der monarchietreuen Deutschen in Pola und stellte sich somit gegen den Giornaletto und die Mehrzahl der italienischen Zeitungen, die sich politisch gesehen gegen die Interessen der Monarchie bzw. die gesammtösterreichischen Interessen stellten. Die Besorgnis der Führung der Kriegsmarine, unter der Leitung des Hafenadmirals J. Ripper, der für die militärisch-politische Sicherheit der Hauptkriegshäfen zuständig war, und der immer stärker werdende Irredentismus bei einem Teil der italienischen Bevölkerung, führte dazu, dass sich die Verwaltung der Kriegsmarine nach den Wahlen im Januar 1905 in den Kampf für die Kommunalwahlen in Pula im Jahr 1907 eingemischt hat. Das lief zugleich auf die Ausnutzung ihres Einflusses auf die öffentliche Meinungsbildung hinaus, so dass man von einer Einflussnahme der Marine auf die Zeitungsgründung sprechen kann. Das Polaer Tagblatt vertrat kontinuierlich ausschließlich die Interessen der Kriegsmarine.
Der erste Eigentümer war ein Konsortium mit dem österreichischen Industriellen Karl Kupelwieser an der Spitze. Vor Beginn des Erscheinens des Blattes hatten K. Kupelwieser und der Marineoffizier Guido von Henriquez vom österreichischen Ministerpräsidenten Paul Baron von Gautsch verlangt, ihnen zum Zweck der Zeitungsgründung ein zinsenfreies Darlehen von 5.000 Kronen zu gewähren. Mit Unterstützung der Hafenadmiralität von Pola und der Zustimmung des k.u.k. Kreishauptmannes in Pola, Philipp Reinlein von Marienburg und des Statthalters in Triest Prinz Konrad Hohenlohe, bewilligte der Ministerpräsident den Initiatoren des Blattes 3.000 Kronen aus einem staatlichen Fonds für die Verlagsgründung.
Außer diesen Mitteln hofften die Gründer auf die Unterstützung von etwa 4.500 in der Stadt lebenden Deutschen, unter denen sie einige hundert Abonnenten gewannen. Daraufhin begannen sie mit der Veröffentlichung der Zeitung und verkauften anfangs zirka 600 Exemplare. Bis zum Ende des Jahres hatte die Zeitung schon 1.400 Abonnenten. Diese waren, abgesehen von Pola, aus anderen Orten Istriens (etwa 80), aus Lošinj (40), Triest (über 50), aus anderen Kronländern (50), aus Wien (über 50) und 60 waren Bezieher aus dem Ausland. Nach der sozialen Struktur befanden sich unter den Abonnenten am meisten Staatsbeamte, Offiziere und Unteroffiziere und eine geringere Zahl Arbeiter vertreten.
Während des ersten Erscheinungsjahres war das Blatt wegen der geringen Abonnentenzahl von staatlichen Subventionen abhängig. Im Jahr 1906 verursachte die Herausgabe der Zeitung solche Verluste, dass der damalige Verleger – das Konsortium, mit K. Kupelwieser an der Spitze – zurücktreten und die Verlagsrechte dem kroatischen Drucker und Verleger Josip Krmpotić überlassen musste. Die einzigen für den Betrieb des Blattes verbliebenen Mittel waren jene aus dem genannten staatlichen Fonds. Die jährliche Subvention betrug bis 1908 3.000, später 2.000 Kronen. Teilweise wurde die Zeitung durch Inserate und Abonnements finanziert. Die Zeitung wurde in einer Auflage von ungefähr 1.400 Stück gedruckt.
Der Sitz der Redaktion befand sich in der Druckerei des kroatischen Druckers und Verlegers Josip Krmpotić, der die Zeitung herstellte. Das Polaer Tagblatt redigierten Ferdinand Stepanek (ab 15.10.1905); Otto Ottisch (ab 16.11.1905), Gustav Trippold (ab 28.10.1906), Hugo Dudek (ab 27.3.1908), Ferdinand Stepanek (ab 31.12.1909.), Rudolf Schwendtbauer (ab 1.1.1910.), Joseph Sonntag (ab 1.10.1910.) und wieder Hugo Dudek (ab 1912); ab 13.1.1914 bis zum Ende ihres Erscheinens wurde H. Dudek, der am längsten Redakteur war, als Redakteur und Herausgeber angegeben. Sie führten die Redaktion in Übereinstimmung mit den Interessen der Marine bzw. des Staates, vertraten aber gleichzeitig auch die Interessen der Kroaten und Slowenen Istriens gegenüber italienischen Aspirationen.
Die Zeitung veröffentlichte Nachrichten aus aller Welt und Lokalnachrichten, besonders jene, die die k.u.k.Marine betrafen. Zwischenzeitlich gab sie auch die Beilagen: Frauen Zeitung (1906) und Illustriertes Unterhaltungsblatt (1908, 1910 und 1911) heraus.
Illustrierte österreichische Riviera-Zeitung (1904-1906) aus Pola und Abbazia
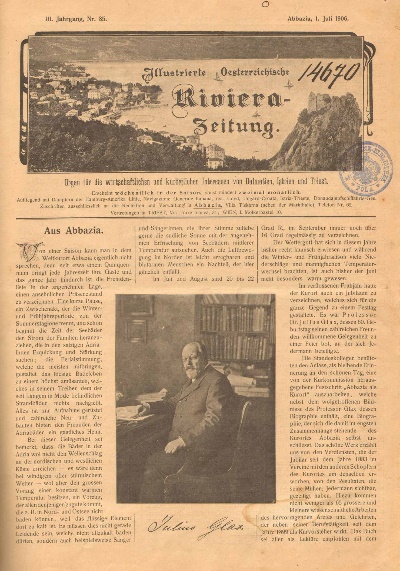
Die „Illustrierte Österreichische Riviera-Zeitung“ mit dem Untertitel „Organ für die wirtschaftlichen und kurörtlichen Interessen von Dalmatien, Istrien und Triest“ war die erste Zeitung, die der Tourismuswerbung der adriatischen Ostküste diente und die erste illustrierte Zeitschrift in Pola. Sie wurde in Pola vom 15.4.1904 bis März 1905 herausgegeben, danach in Abbazia/Opatija (bis September 1906). Herausgeber und Chefredakteur des Blattes war Friedrich J. Weiss, verantwortliche Redakteure waren Ferdinand Štěpánek (er redigierte für kurze Zeit das Polaer Tagblatt) und Alfred Hartmann. Die Zeitung wurde als Wochenschrift in einer Auflage von 2.500 Exemplaren gedruckt. Der Kommissions-Verleger dieser Zeitung– wie auch des Wochenblattes Pola – war die „Schrinnersche Buchhandlung“.
Der Hauptzweck des Blattes war die Präsentation des Fremdenverkehrs- und Kurangebotes Istriens und Dalmatiens für ausländische Gäste. Veröffentlicht wurden Beiträge über Geschichte, Wirtschaft, Volkskunde, Möglichkeiten des Fremdenverkehrs und Kurbetriebs sowie über die Naturschönheiten der österreichischen Riviera, über Kultur und Sport und auch zahlreiche Werbebeiträge. Der Vertrieb wurde auf den Seerfahrtslinien der größeren europäischen Schiffsagenturen organisiert. Das Blatt wurde vom Staat subventioniert und hatte eigene Büros in Triest, Wien und New York.
Brioni Insel-Zeitung (1910-1914)

Die Brioni Insel-Zeitung erschien als Wochenblatt (von Mitte Februar bis Ende Oktober), bzw. als Monatsschrift auf den Brioni-Inseln. Paul Kupelwieser (Wien, 1843–1919), seit 1893 Besitzer der Inseln, gab sie heraus. Das Blatt erschien vom 6.2.1910 bis zum 8.3.1914. Die Redaktion befand sich auf der Insel Brioni (heute Brijuni), Redakteure waren Otto Buchbaum, danach Siegmund Oswald-Fangor (seit 1913). Die Zeitung bestand aus zwölf Seiten und Abbildungen und wurde in der Druckerei „A(dolf) Fischer e C.“ in Pola, ab 1913 bei Herrmanstorfer in Triest gedruckt.
Im Jahr 1910, als diese Wochenzeitung gegründet wurde, zählte die Inselgruppe nur 287 Einwohner. Daher war die Ausgabe des luxuriös ausgestatteten Wochenblattes für die damaligen Verhältnisse außergewöhnlich. In der Einleitung der ersten Ausgabe begründete die Redaktion, dass die Zeitung an alle diejenigen gerichtet sei, die auf diese Insel kamen oder noch kommen wollten und dass das Blatt alle Geheimnissee dieser Inseln offenbaren würde:
„Und ihnen allen, die dieses kleine Inselland gekannt, die sich in seinen Lorbeerwäldern, an seinem Strand, auf seinen kleinen Inselklippen wie in einem zweiten glücklichen Zuhaus gefühlt haben, erzählt nun das kleine Blatt der kleinen Insel allwöchentlich, wie hier unten am Meer das Leben Luft und was sich sonst tut, auch erratend alle Fragen, die an Brioni und sein Werden alltäglich gestellt werden. (…) So werden alle Geheimnisse des Brioni-Betriebes zwischen den Spalten unserer Inselzeitung aufgedeckt werden.“ (Brioni Insel-Zeitung, 6. 2. 1910., Nr. 1.)
Das Blatt richtete sich an die Elitegäste aus aller Welt, die sich hier aufhielten, um den Fremdenverkehr auf diesen Inseln zu fördern. So wurden in ihr Fortsetzungsromane, Gedichte, Nachrichten über archäologische Forschungen auf den Inseln sowie Meldungen über den Aufenthalt von Mitgliedern der Herrscherdynastien, Künstlern und anderer angesehener Gästen veröffentlicht.
Die Zeitung wurde in hoher Auflage von 1.000 Exemplaren gedruckt, um für den Fremdenverkehr auf den Brioni-Inseln zu werben.
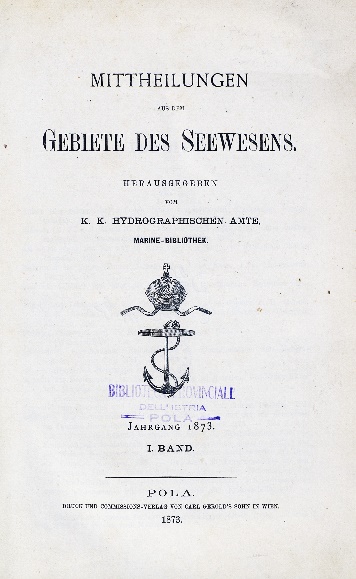 Mittheilungen aus dem Gebiete des Seewesens
Mittheilungen aus dem Gebiete des Seewesens
Mittheilungen aus dem Gebiete des Seewesens
In Pula wurde am 10.9.1869 das Hydrographische Amt der k. u. k. Kriegsmarine gegründet. Es bestand aus vier Abteilungen: Die Sternwarte mit dem astronomischen, meteorologischen, geomagnetischen und dem Gezeitenobservatorium, das Depot für nautische Instrumente mit einer mechanischen Werkstatt, das Depot mit Seekarten und Marinebibliothek. Im Jahr 1895 wurde die Abteilung für Geophysik gegründet. Das neue Gebäude des Amtes wurde am 20.6.1871 eröffnet. Das Institut erzielte viele Erfolge im Bereich der Wissenschaft und Forschung, insbesondere gilt das für das astronomische Observatorium, in dem der Astronom Johann Palisa von 1874 bis 1880 28 Planetoiden entdeckte. Zwischen 1866 und 1872 wurde das Adriatische Meer neu vermessen. Aufgrund dieser Vermessung wurden im Zeitraum 1870–74 in Wien Seekarten der Adria hergestellt. Das Amt veröffentlichte 1892 das Segelhandbuch der Adria. In den Jahren 1889 und 1890 wurden geomagnetische Vermessungen der Adria durchgeführt. Das meteorologische Observatorium begann 1874 tägliche Wetterkarten zu liefern. Von 1873 bis 1915 veröffentlichte das Hydrographische Amt die monatliche Zeitschrift Mittheilungen aus dem Gebiete des Seewesens. Durch den Zerfall der Monarchie und die italienische Besatzung von Pula am 5.11.1918 endete die Tätigkeit des Hydrographischen Amts. Die italienische Kriegsmarine übernahm das Amt und brachte einen großen Teil der Ausrüstung nach Italien. Das Gebäude des Amtes wurde 1944 durch ein angloamerikanisches Bombardement zerstört (erhalten wurde nur eine Kuppel der Sternwarte).
Die Zeitschrift Mittheilungen aus dem Gebiete des Seewesens erschien monatlich in Bändchen, die von 50 bis mehr als 100 Seiten hatten. Seine Aufgabe war, die Mitglieder der österreich-ungarischen Marine mit dem technischen und militärischen Fortschritt der Kriegsmarinen in der Welt (oft durch die Übersetzungen aus anderen Zeitschriften der Welt) vertraut zu machen. Gleichzeitig gab sie den Offizieren, Ingenieuren und anderen Fachleuten der k.u.k. Marine die Gelegenheit, selber solche Arbeiten aus dem Bereich von Hydrographie, Schifffahrt, Schiffmaschinentechnik, Militärtechnik und Bewaffnung, Meteorologie, Seekriegsgeschichte, sowie viele Besprechungen von fachlichen und wissenschaftlichen Publikationen und Artikeln zu veröffentlichen. Der erste Redakteur war der Linienschiffsleutnant Wenzel Paradeiser (von 1873 bis zu seiner Pensionierung 1893). Nach ihm redigierten die Zeitschrift der Linienschiffsleutnant Eduard v. Norman-Friedenfels (1893-1905), der pensionierte Linienschiffskapitän Leonidas Pichl (1905-1913) und der Korvettenkapitän Karl Reichenbach (1913-1914/15). Bis zum Jahr 1915, als das Verlegen der Zeitschrift wegen des Kriegs eingestellt wurde, wurden 42 Jahrgänge veröffentlicht. Gedruckt wurden sie in der Wiener Druckerei Carl Gerold’s Sohn und ab Anfang des 20. Jahrhunderts in der Polaer Druckerei von J. Krmpotić.
Jahresberichte der Polaer Schulen in deutschen Sprachen
Für deutschsprachige Österreicher wurde in Pula ein vollständiges System der deutschsprachigen Schulen aufgebaut. Unmittelbar vor dem Ersten Weltkrieg wirkten in der Stadt folgende deutsche Schulen: Das staatliche Obergymnasium, die k. u. k. Marine-Unterreal-Schule, die ab 1908 k. k. Staatsrealschule hieß, die Staatliche Volksschule für Knaben, die Staatliche Volksschule für Mädchen. Die k. u. k. Marine gründete die k. u. k. Marine-Volks-Schule für Mädchen und Knaben (diese Schule besuchte die österreichische Schriftstellerin Paula v. Preradović (1887 – 1951), die Enkelin des Dichters P. Preradović, die in ihrer Autobiographie die Kompetenz ihrer Lehrer lobte), die k. u. k. Maschinenschule für Marineunteroffiziere und die Lehrlings-Schule im See-Arsenal.
Die k. u. k. Marine-Unterrealschule in Pola wurde gegründet, damit die Kinder aus immer zahlreicheren Familien der Offiziere und Staatsbeamten in Pula einen deutschsprachigen Unterricht bekommen konnten, weil es in Pula vor dem Jahr 1856, als die starke Zuwanderung in die Stadt begann, nur zwei italienische Volksschulen gab. Im Jahr 1856 wurde das Problem des Mangels an deutschsprachigen Schulen vorübergehend dadurch gelöst, dass der Marinepriester J. Germek die deutschen Kinder privat unterrichtete. Die Kinder mussten am Ende des Schuljahres eine öffentliche Prüfung in der deutschen Schule in Mitterberg (Pazin) ablegen. Diese Privatschule existierte bis zum Jahr 1862. Später konnte man einen solchen Unterricht wegen stark wachsender Zahlen der Schüler nicht mehr organisieren. Deswegen versuchte die Marineführung die Gemeinde von Pula zu veranlassen, eine deutschsprachige Schule zu eröffnen, aber die Vertreter der Stadtverwaltung bestanden hartnäckig auf dem Italienischen als der Unterrichtssprache. Die Marineführung wendete sich dann an den Erzherzog Ferdinand Maximilian, den Oberbefehlshaber der Kriegsmarine, und forderte die Gründung einer deutschen Volksschule in Pula. Im Oktober 1862 wurde eine solche Schule mit vier Klassen für Knaben und drei Klassen für Mädchen eröffnet. Die Schule bekam im Jahr 1908 den Rang einer Unterrealschule.
Der Redakteur, beziehungsweise der Autor der ersten Jahresberichte, war der Schuldirektor L. Peiker, später machte das der Schuldirektor L. Neugebauer. Der Verleger der Berichte war die Schule selbst. Die Jahresberichte erschienen immer am Ende des Schuljahres. Außer den statistischen Angaben über Schüler, Listen der Schüler und Lehrer und Übersichten der bedeutenderen Ereignisse in der Schule während des Schuljahres brachten sie oft auch eine wissenschaftliche oder fachliche Arbeit von einem der Lehrer. Am bekanntesten sind die wissenschaftlichen Arbeiten des Polaer Archäologen und Konservators Anton Gnirs, zum Beispiel: „Das Gebiet der Halbinsel Istrien in der antiken Überlieferung“. Anton Gnirs (1879 -1933) wurde 1899, nach dem Studium an der Universität in Prag, Professor an dieser Schule in Pula. In den Berichten dieser Schule veröffentlichte er vier wissenschaftliche Arbeiten.
Im Bericht für das Schuljahr 1902/1903 erschien die deutsche Übersetzung der Beschreibung von römischen Bauten in Pula vom englischen Architekt Thomas Allason mit fünf qualitätsmäßig hochwertigen photomechanischen Reproduktionen von Veduten Polaer römischer Monumente aus dem Original Alassons (das 1819 in London veröffentlicht worden war).
Die ersten Berichte dieser Schule druckte G. Seraschin, die späteren bis zum Jahr 1906 wurden in der Laibacher (Ljubljana) Druckerei Kleinmayr & Bamberg gedruckt. Die letzten zwei Berichte druckte Josip Krmpotić in Pula.
2. Jahresbericht der K. k. Staats-Unterrealschule in Pola; der Titel ab der Schuljahr 1908/1909: Jahresbericht der k. k. Staatsrealschule in Pola. Pula, Jahrgänge 1 (1907/08) - 7 (1913/14); 21 cm.
Verleger dieser Jahrberichte war die k. u. k. Marine-Unterrealschule in Pula, die im Jahr 1908 den Rang einer k. u. k. Staats-Unterrealschule bekam. Die Schulberichte schlossen auch eine (oder zwei) wissenschaftliche oder fachliche Arbeit von Professoren dieser Schule sowie den Bericht des Schulleiters ein. Einige von diesen wissenschaftlichen Arbeiten werden noch heute geschätzt, zum Beispiel die Beiträge über die Geschichte vom Pula und Istrien von Polaer Archäologen Anton Gnirs. Unter den übrigen Autoren, deren Beiträge in diesem Jahrbuch ebenso veröffentlicht wurden, findet man folgende Professoren: R. Solla, R. Riegler, M. Filzi und P. Pirker. Alle diese Jahresberichte druckte Josip Krmpotić in Pula.
3. Das Programm des K. k. Staats-Gymnasiums in Pola
Die Jahresberichte des K. k. Staats-Gymnasiums in Pola erschienen von 1891 bis 1914. Gedruckt wurden sie in den Polaer Druckereien von L. Bontempo, J. Krmpotić, C. Martinolich und in der Triester Druckerei von G. Balestra. Als Beilagen wurden die Arbeiten folgender Professoren veröffentlicht: K. Aigner, M. Filzi, A. Kürti, H. Graber usw. Einige wissenschaftliche oder fachlichen Beiträge der Schulprofessoren, die in diesen Jahrberichten veröffentlicht wurden, veröffentlichte J. Krmpotić im Jahr 1914 als besondere Publikationen beziehungsweise nach Bestellung durch die genannte Schule.
Die erste Mittelschule in Istrien wurde 1836 im Franziskanerkloster von Mitterburg (Pazin) mit dem Unterricht in deutscher Sprache gegründet. Im Jahr 1873 bekam sie den Rang eines Staatsgymnasiums (Kaiserlich-königliches Staats-Obergymnasium in Mitterburg). 1890 zog sie von Pazin nach Pula um. (Sehe: Swida, F., „Zur Geschichte des Gymnasiums von Mitterburg“, in: Programm des k. k. Staats-Gymnasiums in Pola veröffentlicht am Schlusse des Schuljahres 1891, Pola: k. k. Staatsgymnasium, 1891., S. 5-27.
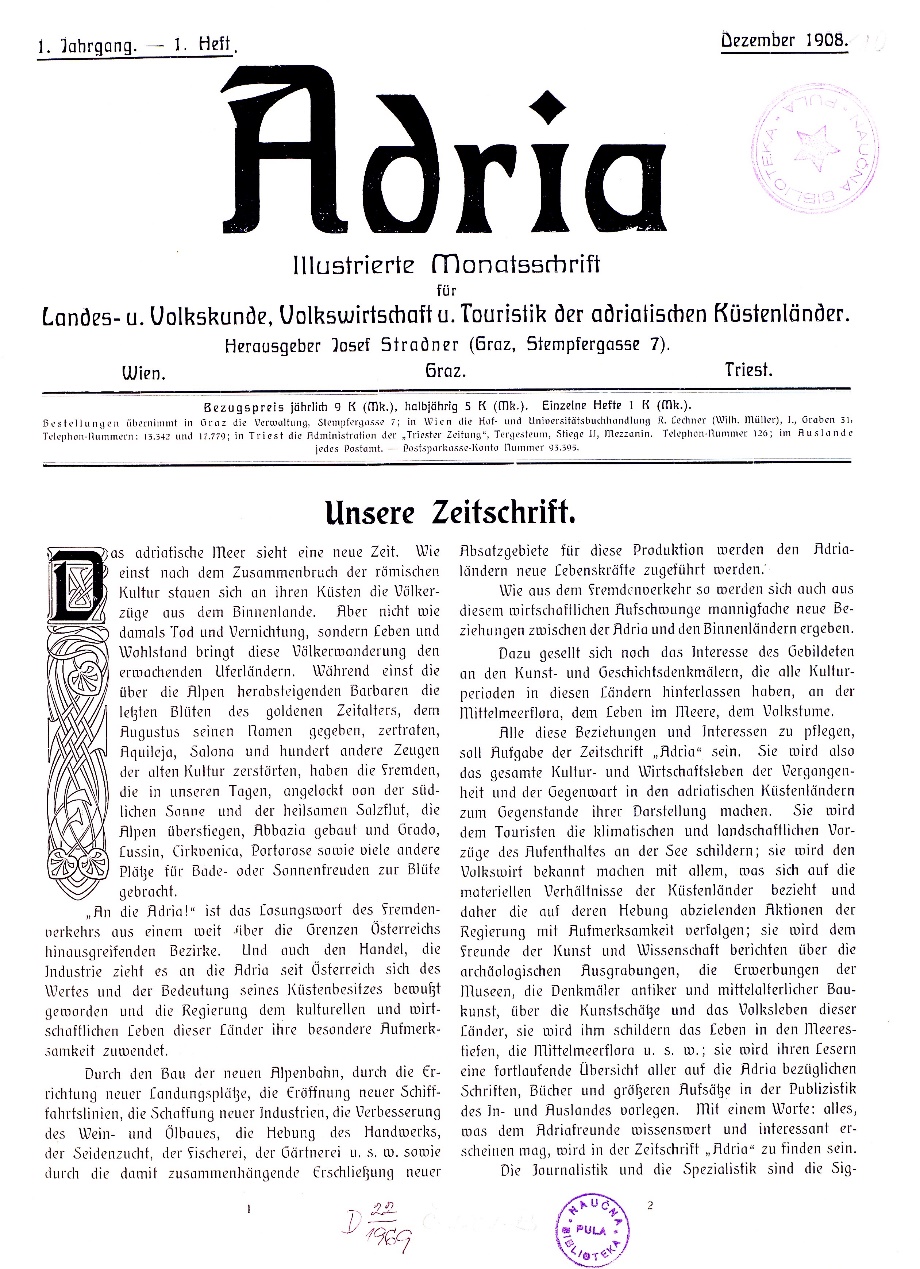
Wie wird das digitalisierte Material durchsucht und gelesen?
Das Material wird mit dem Acrobat Reader gelesen. Durchsuchen kann man nach Titeln, Jahrgängen und Nummern der Ausgabe. Die Jahrgänge werden nach Nummern geordnet. Die Benützer wählen zuerst den Zeitungstitel, dann den Jahrgang und danach die Nummer der Ausgabe und die gewünschte Seite.
Man kann den ganzen Text folgender Zeitung durchsuchen:
Gebrauchsbedingungen
Die auf der Internetseite von INO veröffentlichten Reproduktionen von Materialien im Bestand der Universitätsbibliothek dürfen nur für persönlichen Gebrauch und wissenschaftliche Forschung benützt werden. Weitere Veröffentlichungen im Internet und jede Art Vervielfältigung sind nicht gestattet.
Der Antrag auf Erteilung einer Erlaubnis zum kommerziellen Gebrauch der Reproduktionen muss in schriftlicher Form bei der Universitätsbibliothek in Pula gestellt werden. Jede Verwendung der Bilder und Texte im Bestand der Universitätsbibliothek soll mit folgendem Vermerk versehen sein: © INO, Sveučilište Jurja Dobrile u Puli, Sveučilišna knjižnica
Die Benützer, die die Herstellung digitaler Reproduktionen in Druckqualität bestellen wollen, müssen dafür einen schriftlichen Antrag stellen. Die Bibliothek wird die beantragten digitalen Reproduktionen in Übereinstimmung mit dem entsprechenden Bibliotheksregelwerk ausführen.
ANHANG:
Zeitungswesen in Istrien ab den sechziger Jahren des 19. Jahrhunderts bis zum Ende der Habsburgermonarchie
Die Anfänge des Zeitungswesens in Istrien
Die Anfänge des Zeitungswesens in Istrien gehen auf die Einführung des parlamentarischen politischen Lebens in der Habsburgermonarchie im Jahr 1861 und das Inkrafttreten der Verfassung aus dem Jahr 1867 im österreichischen Teil der Monarchie zurück. Die erste kroatische Zeitung – Naša sloga – erschien erst neun Jahren nach der Gründung des Landtags und zwei Jahre nach Inkrafttreten der österreichischen Verfassung.
Durch die Einführung einer liberalen Verfassung im Jahr 1867, die die „Grundrechte“ der Bürger verbürgte (Gleichheit vor dem Gesetz, Glaubens- und Gewissensfreiheit, die Unantastbarkeit des Eigentums, Gleichberechtigung aller Völker im österreichischen Teil der Monarchie usw.), wurde der Weg für die Demokratisierung der Gesellschaft im Rahmen der „verfassungsmonarchischen“ Herrschaftsform freigemacht. Durch die allmähliche Erweiterung des Wahlrechts (das am Anfang mit einem Eigentumszensus verbunden war) konnten sich die istrischen Untertanen zum ersten Mal durch die Wahl ihrer Vertreter im Reichsrat, im istrischen Landtag und in den Gemeinderäten am politischen Leben beteiligen. Schnell wurden viele nicht-politische und politische Vereine gegründet (in Istrien handelte es sich meistens um die Lesevereine) und die Verbreitung der Lesekenntnisse brachte es zu einem schnellen Wachstum der Buch- und Zeitungsverlage und zur Formung der politischen öffentlichen Meinung durch die Zeitungen.
Unter den Bedingungen ethnischer Vielfalt der Bevölkerung Istriens und immer häufigeren national-politischen Auseinandersetzungen zwischen den italienischen und kroatischen Bläätern, die in Istrien seit dem Anfang der 1860-ger und 1870-ger Jahren bis 1918 erschienen, waren die Zeitungen nicht nur ein Mittel zur Übertragung der Informationen, sondern auch Anreger national-politischer Organisierung von Mitgliedern einer Volksgruppe, mit dem Ziel, die politische Überlegenheit eigener ethnische Gruppe im istrischen Landesrat und in den lokalen Gemeinderäten gegenüber der konkurrierenden Ethnie zu erreichen. Aus diesem Grund war der Großteil der istrischen Journalisten vor dem Ersten Weltkrieg national-politisch gefärbt.
Die Gründung und Verlegung einer Zeitung forderte bedeutende finanzielle Unterstützung. Das entwickelte italienische Bürgertum finanzierte das italienische Zeitungswesen, das seinen national-politischen und wirtschaftlichen Interessen dienen sollte. Da die kroatische Bevölkerung in Istrien meistens aus den armen und schreibunkundigen Bauern bestand und das kroatische Bürgertum zahlenmäßig und wirtschaftlich schwach war, wurden die kroatischen Zeitungen, Zeitschriften und Bücher viel später als die italienischen Publikationen gegründet und in deutlich kleineren Auflagen gedruckt. Das gilt auch im Vergleich zu den entsprechenden Publikationen in anderen kroatischen Gebieten. Im Jahr 1913, zum Beispiel, erschienen in Istrien 12 Zeitungen in italienischer Sprache, 6 in deutscher und nur 4 in kroatischer.
Folgende Zeitungen, die im genannten Zeitraum in Istrien gedruckt wurden, werden auf unserer Internetseite angeboten:
Naša sloga (Triest 1870-1899, Pula, 1899-1915) (“Unsere Eintracht“, kroatische Zeitung)
Naša sloga (“Unsere Eintracht“) (Triest 1870-1899, Pola/Pula, 1899-1915) – die erste kroatische Zeitschrift in Istrien, mit dem Untertitel: „Das erzieherische, wirtschaftliche und politische Blatt“ – kam ohne großen Aufwand an die Leseöffentlichkeit. Alles war klein bei diesem „Blättchen“ (wie es sein Begründer Juraj Dobrila genannt hat): sein Format (34 x 24 cm), sein Umfang (4 Seiten), sein Preis (besonders günstig für die Bauern), die Veröffentlichungsfrequenz (am Anfang erschien es zweimal im Monat, erst ab 1884 wöchentlich), die Anzahl seiner Mitarbeiter (meistens waren sie Priester oder Lehrer), seine Finanzierung und seine Auflage (am Anfang etwa 500 Exemplare).
Die erste Nummer erschien am 1.6.1870 in Triest, nachdem Bischof Juraj Dobrila und „ein bekannter Unsriger“ (wahrscheinlich Bischof J.J. Strossmayer) die finanziellen Mittel für das Verlegen von 400 Exemplare dieser Zeitschrift bereitgestellt hatten. Dobrila war am Anfang nicht sicher, ob ihr Erscheinen auf einen Widerhall unter den kroatischen Bauern – für die die Zeitung hauptsächlich gedacht war – treffen würde. Seine Hoffnung war, dass man durch Abonnements weitere 100 Exemplare verkaufen könnte. Am Ende der Jahres 1870 waren sie aber positiv überrascht, weil die Zahl der Abonnenten auf Tausend gestiegen war.
In der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts einige bedeutende Mitglieder italienischer bürgerlicher Intelligenz in Istrien verbreiteten ideologische etnische Vorurteile in ihren Zeitungen und Büchern. Sie stellten die istrischen Kroaten und Slowener als unzivilisierte Vertreter „barbarischer“ Völker dar, die schicksalhaft durch die Übernahme der italienischen Kultur und Sprache zivilisiert werden mussten. Bischof Dobrila und seine Mitarbeiter –meistens Priester – die die Zeitung Naša sloga verlegt haben, nahmen als ihr programmatisches Motto die Leitidee des kroatischen Bischofs Strossmayer „Durch Aufklärung zur Freiheit!”, wobei sie in der ersten Ausgabe des Blatts betonten, dass es sich hier um eine auf der katholischen Religion gegründete Aufklärung handelte.
Die Redakteure gaben sich Mühe, den Still und die Sprache ihrer Artikel an ihre Leser anzupassen. Zu diesem Zweck führten sie am 16. 8. 1871 eine neue Rubrik namens „Franina i Jurina“ ein, die beim Volk bald sehr beliebt war. Es handelte sich um Gespräche zweier Bauern im istrischen čakavischen Dialekt, geschrieben in einer Art, die der kroatischen bäuerlichen mündlichen Überlieferung sehr nahe stand. Das häufigste Thema dieser Gespräche war der Spott über jene Mitglieder kroatischer Volksgruppe, die in den Wahlen ihre Stimme der italienischen bürgerlich-liberalen Partei gegeben hatten.
Der erste verantwortliche Redakteur des Blatts war der Priester Antun Karabaić (1832 – 1906). Die am längsten amtierenden Redakteure waren die Priester Mate Bastian (1828 – 1885) (er führte die Zeitung in den 1870-er Jahren) und Matko Mandić (1849 – 1915), der von 1883 bis zu seinem Tod der Redakteur war. Dr. Matko Laginja redigierte die Zeitung in den Jahren 1881 und 1882.
Bis zum Jahr 1884 erschien das Blatt zweiwöchentlich, danach als Wochenblatt, und von 1900 bis 1902 zweimal wöchentlich. Am Anfang war seine Auflage 500 Exemplare, am Ende der 1870-er wurde das Blatt aber in mehr als 2000 Exemplare gedruckt.
In der letzten Nummer des Blatts vom 25.5.1915 informierte die Redaktion seine Leser: „Wegen Mangel an Arbeitskraft (wegen der Evakuierung der zivilen Bevölkerung aus dem breiteren Bereich des Kriegshafens Pola) finden wir uns nach 45 Jahren gezwungen, die Verlegung unserer Zeitschrift einzustellen und auf bessere Zeiten zu warten.“ Statt diesen „besseren Zeiten“ erfolgte aber die Besatzung Istriens durch die italienischen Truppen und als die Faschisten kurz danach an die Macht kamen, wurde das Verlegen aller kroatischen Zeitungen und Bücher verboten.
Il Diritto Croato (Pola, 1888 - 1894) (eine kroatische Wochenzeitung, die in italienischer Sprache verlegt wurde)
Die erste kroatische Zeitung aus Pola – die Wochenzeitung Il Diritto Croato – erschienen von 1888 bis 1894 in italienischer Sprache, nach dem Vorbild von ähnlichen kroatischen Zeitungen, die in Dalmatien in italienischer Sprache veröffenlicht worden waren. Durch diese Zeitung wollte man bei den Bürgern kroatischer Abstammung, die wegen ihrer Schulung die italienische Sprache besser als die kroatische kannten, das Gefühl ihrer Zugehörigkeit zum kroatischen Volk formieren und den assimilierenden Einfluss der romanischen Kultur neutralisieren. Sein Anreger, Eigentümer, Verleger und Redakteur war Ante Jakić, der aus Makarska nach Pula gezogen war. Neben Tagesnachrichten informierte das Blatt seine Leser über die kroatische Geschichte, Literatur und Kultur und veröffentlichte in italienischer Übersetzung die Gedichte von kroatischen Schriftstellern wie August Šenoa, Petar Preradović und Ivan Mažuranić. Die wichtigsten Mitarbeiter des Blatts waren Marin Sabić und Ivan Zuccon.
L’Eco di Pola (Pola, 1889 – 1897) – italienische Wochenzeitung
Diese Polaer moderat-liberale Wochenzeitung erschien von 1889 bis 1897 auf vier Seiten, in einer Auflage zwischen 300 und 1.200 Exemplaren. Obwohl sie nach ihrem Untertitel „Politische Wochenzeitung“ hieß, fand man darin neben Nachrichten aus Istrien, aus der Monarchie und aus der Welt, detaillierte Berichte über lokale Themen, aber auch Gedichte, Feuilletons, Bücherrezensionen und polemische Texte. Für diese Zeitschrift schrieb auch Giuseppina Martinuzzi, eine der wenigen istrischen Autorinnen von Zeitungstexten. Die Zeitschrift vertrat italienische national-patriotische Ansichten, aber ebenso eine Loyalität zur Monarchie – deswegen wurde sie seit dem Jahr 1891 vom Staat mitfinanziert. Sie polemisierte gegen die italienischen (Il Giovine Pensiero) und die kroatischen (Il Diritto Croato, Naša sloga) Zeitungen.
Il Popolo Istriano (Pola, 1898 – 1906) (italienische politische Wochenzeitung)
Diese italienische politische Wochenzeitung, gegründet von Giovanni Timeus, setzte sich für die Verwirklichung wirtschaftlicher und politischer Interessen von istrischen Italienern durch eine nahe Zusammenarbeit mit Italien ein. Sie ließ sich dabei in die Polemiken gegen die slawische Bevölkerung Istriens und gegen die Kriegsmarine in Pula verwickeln. Die Zeitung förderte das Verbreiten der italienischen Sprache und Zivilisation in Istrien. Dabei ging es ihr, wie G. Boaglio bemerkte, „nicht nur um die Sicherung eigener Minderheitenrechte, sondern um die Bezwingung anderer Sprachen und Kulturen.“
Il Giornaletto di Pola (Pola, 1900 - 1915) (italienische Tageszeitung)
Nach dem Muster der Triester Tageszeitung Il Piccolo, die auch in Istrien gern gelesen wurde, wurde im Jahr 1900 in Pula die Tageszeitung Il Giornaletto di Pola gegründet. Sein Gründer war der istrische italienische Journalist Giovanni Timeus (Motovun 1864 - Rom 1946), der ebenso ihr Hauptredakteur war, bis zu den letzten Jahren, in denen diese Position Giovanni Salata übernahm. Die anderen Redakteure waren A. Rinaldi, E. Godas, V. Venier, F. Manzutto und G. Salata. Nach dem Ersten Weltkrieg wurde das Blatt im November 1918 wieder gegründet, wurde aber aufgrund von fehlendem Leserinteresse am 20. Januar 1920 wieder eingestellt.
Giornaletto war das Sprachrohr der regierenden italienischen Bürgerlich-liberalen Partei. Die Zeitung betrachtete Istrien als „das italienische Nationaleigentum“ und setze sich deswegen unablässig mit dem deutschsprachigen Polaer Tagblatt und mit den kroatischen Zeitungen Omnibus und Naša sloga auseinander. Wegen ideologischer Differenzen griff sie die Polaer sozialistische Zeitung Il Proletario und das Wochenblatt L’Avvenire an, das die Stellungen der Christlich-sozialer Partei vertrat. Mit einer durchschnittlichen Auflage von 5000 Exemplaren war sie in den Zeiten der Habsburgermonarchie die auflagenstärkste Zeitung in Istrien. Gedruckt wurde sie auf nur zwei Seiten in der Polaer Druckerei Boccasini & Comp. Die ausgeprägt informative Zeitung mit kurzen Nachrichten, die für ein breites Publikum gedacht wurden, war stark marktorientiert, mit vielen bezahlten Annoncen und Werbungen, die, neben Abonnements, eine wichtige Quelle ihrer Finanzierung waren. Um möglichst viele Leser zu erreichen, hatte sie ein kleines Format und einen sehr niedrigen Preis (2 Kronen, während die meisten anderen Zeitungen 6 Kronen kosteten). In September 1915 wurde ihr Verlegen eingestellt, weil ihr Besitzer Timeus nach der italienischen Kriegserklärung an die Habsburgermonarchie nach Italien emigrierte (Timeus arbeitete dort in dem Informationsbüro der italienischen Kriegsmarine).
Il Proletario (Pula, 1900-1905; von 1905 bis 1907 erschien sie unter dem Titel La Terra d’Istria) (italienische sozialistische Tageszeitung)
In den ersten Jahren des 20. Jahrhunderts gründeten die Sozialistische und die Christlich soziale Partei in Pola eine gemeinsame Zeitung, die länger als vier Jahre erschien. Die sozialistische Zeitung beschäftigte sich hauptsächlich mit den für die Arbeiter bedeutenden sozialen Fragen. Im Gegensatz zu den klerikalen und nationalistischen bürgerlich-liberalen Zeitungen, wollten sie die Arbeiter aller Nationen unter ein Dach bringen. Am Anfang setzte sich diese Tageszeitung (später erschien sie wöchentlich) für den Internationalismus ein, aber nach der Verschärfung der national-politischen Konflikten in Pula in den Jahren 1904 und 1905 – die die Ansichten der Führung der Polaer und der istrischen Sozialistischen Partei über die national-politische Frage in Istrien und in Österreich wesentlich beeinflusst hatten – lavierte das Blatt zuerst zwischen dem Internationalismus und dem italienischen Nationalismus, um sich ab dem Jahr 1905 unter dem neuen Titel La Terra d’Istria für die Verteidigung italienischer nationaler Interessen als die fundamentale national-politische Ausrichtung der Zeitung zu entscheiden.
Hrvatski list (Pula, 1915-1918) (Tageszeitung in kroatischer Sprache)
Die Tageszeitung erschien in Pula von 1.7.1915 bis 18.7.1918. Ihr Besitzer, Verleger und Drucker war Josip Krmpotić (1864-1949).
Als Redakteure wurden Josip Hain (vom Anfang der Zeitung bis zum 1.8.1918), Ivan Markon (bis zum 1.10. 1918) und Lovro Scalier (bis zum 15.12.1918) genannt. Mijo Mirković schreibt, dass Mario Krmpotić, der Sohn des Besitzers, ebenso ihr Redakteur war.
Ihre Auflage betrug am Anfang 500 Exemplare, später erreichte sie 1700 Exemplare. Das Blatt hatte 2 bis 4 Seiten. Die Tageszeitung hatte folgende regelmäßige Rubriken: Kriegsberichte, Nachrichten aus der Osterreich-Ungarischen Monarchie, Landesnachrichten (bezogen auf Istrien und Dalmatien), Fortsetzungsromane und Annoncen.
Einen besonders hohen historisch-dokumentarischen Wert haben die Nachrichten über das Leiden der zivilen Bevölkerung von Pula und Südistrien, die im Jahr 1915, nach dem Kriegseintritt Italiens, wegen der Gefahr eines italienischen Angriffs auf Pula, in andere Teile der Monarchie umgezogen war. Etwa 50.000 Istrier wurden damals mit der Eisenbahn in andere Teile der Monarchie verschleppt, vor allem in die Vertriebenenlager in Wagna, Gmünd, Pottendorf, Steinklamm und in andere österreichische Orte, im kleineren Umfang aber ebenso in die Gebiete von Ungarn, Mähren und Böhmen. Viele Istrier, insbesondere Kinder und alte Menschen, starben dabei wegen schlechter Lebensbedingungen und an den Folgen der großen Epidemie der sogenannten Spanischen Grippe und an anderen Krankheiten. Die Überlebenden kehrten in den Jahren 1917 und 1918 nach Istrien zurück. Das war die schlimmste Leidensgeschichte der Istrier im Ersten Weltkrieg. Die Tageszeitung berichtete regelmäßig über diese Flüchtlinge.
Seit Ende 1917 bis September 1918 veröffentlichte seine Beiträge in der Tageszeitung Mijo Mirković, der unter dem Pseudonym Mate Balota auch Artikel in südistrischem čakavischem Dialekt schrieb. Mitarbeiter dieser Zeitung waren auch Fran Barbalić und Benjamin Deprato.
In den letzten Jahren der Veröffentlichung setzte sich das Blatt immer stärker für die Einheit der Südslawen ein. Deswegen erschien es vom 9.8.1918 bis zum Ende der Auflage in der „ekavica“ Mundart der kroatischen Sprache. Einige Artikel wurden zensiert; von 30.3. bis zum 6.4.1918 wurde das Verlegen der Zeitung sogar gerichtlich eingestellt.
Kurz nach der italienischen Besetzung von Pula am 5.11.1918 wurde die Zeitung durch die italienische Militärbehörden verboten. Krmpotić wurde zu dreitägiger Haft verurteilt und danach in Italien interniert. Nach seiner Rückkehr nach Pula im Jahr 1920 verbrannten die Faschisten seine Druckerei. Er musste sie verkaufen und für immer Istrien verlassen.
Die Zeitung ist heute sehr selten zu finden. Das Komplett in unserem Bestand ist das einzige, das noch erhalten wurde (es fehlen nur etwa dreißig Exemplare)
Corriere Istriano (Pola, 1934-1938) (Tageszeitung in italienischer Sprache)
Diese Polaer Tageszeitung in italienischer Sprache erschien ab 1.1.1919 unter dem Titel «L'Azione». In den ersten Jahren ihres Erscheinens hatte die Zeitung (laut Dr. Darko Dukovski) „ein sozial-reformistisches Profil und wurde von den italienischen Banken finanziert“. Gegründet wurde sie vom Rechtsanwalt Antonio De Berti, der ihr Direktor, und Bernardo Staffetti, der der verantwortliche Redakteur war. Ihr Verleger war die Aktiengesellschaft „Societa editrice L'Azione“. Bis 1921 blieb die Zeitung unabhängig, danach war sie ein faschistisches Blatt (D. Dukovski). Seit 1922 gehörte sie der „Federazione Fascista Polese“ (Faschistische Föderation von Pula) an, die im Jahr 1924 das Verlagsunternehmen „L'Unione Editrice Istriana“ gründete. Ab 1924 war ihr Zeitungsdirektor Giovanni Mrach (Maracchi) und ihr Redakteur war Giuseppe Leonardelli. Ab 1.1.1929 änderte das Blatt seinen Namen in „Corriere istriano” und wurde zum Organ der Nationalen Faschistischen Partei für Istrien. 1945 wurde sein Verlegen eingestellt.
Auf unserer Internetseite sind die Jahrgänge 1935-1938 zugänglich. Die Leser sollten dabei dem Umstand Rechnung tragen, dass diese Tageszeitung in dem genannten Zeitraum das Organ der Faschistischen Partei war. Dieses Material ist eine zusätzliche Quelle der Informationen über das totalitäre Regime und über die Instrumentalisierung öffentlicher Medien zu politischen Zwecken. Diese Zeitung kann deswegen auch als eine Quelle für die Untersuchung des Faschismus in Istrien genutzt werden.
Die Zeitungsdirektoren: Antonio De Berti – von Nummer 40 im Jahr 1919 bis Nummer 175 im Jahr 1924, Giovanni Mrach (Maracchi) – von Nummer 176 im Jahr 1924 bis zum Ende der Zeitung 1945.
In der Zeitung wurden folgende Hauptredakteure genannt: Bernardo Staffetti – von Nummer 10 im Jahr 1920 bis Nummer 256 im Jahr 1922, Domenico Fabretto (von Nummer 257 vom 4.11.1922 bis Ende Dezember 1925), Giuseppe Leonardelli (von Nummer 174 im Jahr 1924 bis Nummer 1 im Jahr 1926), Giuseppe Sain (von Nummer 1 vom 1.1.1926 bis Nummer 101 im Jahr 1928), Pietro Sfilligoi (von Nummer 102 im Jahr 1928 bis Nummer 27 von 1929), Giovanni Mrach (Maracchi) (von Nummer 28 vom 1.2.1929 bis zum Ende der Zeitung 1945). Ruggero Pascucci wurde als Hauptredakteur für die Ausgabe Nr. 28 vom 1.2.1929 genannt.
Dr. sc. Bruno Dobrić
 Pristupačnost
Pristupačnost

